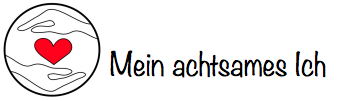Hier finden Sie Reflexionen, Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit.
Ein Lächeln verschenken
Es war einer dieser trüben Wintertage, an denen es gar nicht richtig hell wird.
Ich raffte mich auf, um trotzdem hinauszugehen, einmal, weil mir nach Streuselkuchen zumute war und auch weil ich dachte, es sei besser, sich nicht ganz zu verkriechen. So lief ich durch die Straßen, bekam beim Bäcker meinen Kuchen und beschloss doch bald, wieder in meine schöne, warme Höhle zu flüchten, da ich das Gefühl hatte, dass es heute nichts weiter für mich zu finden gäbe, in all dem Grau.
Auf dem Heimweg erreichte mich dann ganz unerwartet das zarte Lächeln einer Frau, die ich nicht kannte, doch die mich auf diese Weise ganz wundervoll berührte. Dieses Lächeln nahm ich dankbar mit und hielt es für den Rest des Tages wie wie eine Wärmflasche an meine Seele.
Warum schenke ich nicht selbst viel öfter einem anderen so ein Lächeln, frage ich mich, und nehme es mir fest vor.

Unsicherheit genießen?!
Neulich, in einer Yoga-Stunde, übten wir einige recht schwierige Dreh-Asanas, die uns alle aus dem Gleichgewicht und ins Schwanken brachten. „Genieße die Unsicherheit!“ rief unsere Yoga-Lehrerin, eine Aufforderung, über die ich erst recht ins Stolpern kam.
Denn, ganz ehrlich, früher hätte ich damit nichts anfangen können. Unsicherheit war genau das gewesen, was ich immer gründlichst zu vermeiden versucht hatte, entweder indem ich mich möglichst auf alles immer so gut vorbereitete, dass Unsicherheit recht unwahrscheinlich war und indem ich gleichzeitig Situationen vermied, auf die ich mich nicht vorbereiten konnte. Immer schön alles im Griff haben und nie die Kontrolle verlieren, das waren meine Leitsätze, mit denen ich mich durch diese wacklige und oft extrem unsicher wirkende Welt navigierte. Und nun kam jemand daher und rief mir fröhlich zu: „Genieße die Unsicherheit!“
Wie gut, dass ich diesen Satz nicht mit ätzendem Zynismus wegbrennen musste, sondern zulassen konnte, dass mir die Tränen kamen. Denn es rührte mich sehr an, die dahinter liegende Angst in mir wahrzunehmen. Meine Angst vor dem Fallen und vor allem Möglichen und meine vielen, vielen Versuche, diese Angst durch Aktionismus und einem Haufen an Vorsichtsmaßnahmen und Sicherungsvorrichtungen in den Griff zu bekommen, … etwas, das nie wirklich funktioniert hat.
Es hat rund zehn Jahre Training im Loslassen gebraucht, dass ich diesen Satz heute nicht nur zulassen kann, sondern dass er sogar Türen in mir öffnet, die ich vorher selbst fest verriegelt und mit Schildern wie „Betreten verboten!“ versehen hatte.
„Genieße die Unsicherheit“ – ein Satz, der auch bestens zu dem Wort passt, das ich für dieses Jahr für mich ausgewählt habe. Das lautet „Lebendigkeit“. Unsicherheit ist zutiefst lebendig, in jeder Beziehung. Sie zu wagen und vielleicht sogar zu suchen, ist eine neue Herausforderung und ich nehme sie an.

Die Sache mit der persönlichen Kraft
Eine der wichtigsten Aufgaben für mich liegt zur Zeit darin, sehr achtsam mit meiner Kraft zu sein, und ich glaube, dass es zunehmend immer mehr Menschen so geht.
Vor einem Jahr war ich um diese Zeit selbst in Australien – in meinem Herzensland, in meiner Seelenheimat. Wenn ich mich dem, was zur Zeit rund um die Uhr in den Medien und in Social-Media-Kanälen läuft, schutzlos aussetze, gehe ich kaputt. Vollkommen hilflos mit schrecklichen Bildern und Nachrichten bombardiert zu werden, nimmt mir auf Dauer jede Energie und jede Hoffnung. Ohne Hoffnung aber kann ich nicht existieren. Und die Brände in Australien sind ja nur ein Beispiel von vielen.
Wir als Menschheit ernten gerade, was wir gesät haben (und immer noch säen, denn Umdenken und Wandel dauern oft sehr lange). Die Welt braucht jetzt nichts dringender als positive (Tat-)Kraft all derer, die etwas zum Guten verändern wollen. Statt dessen verlieren immer mehr von uns ihre Energie in der Ohnmacht, die all die schlimmen Bilder und Entwicklungen in uns auslösen, mit denen wir überall überflutet werden. Sich zu informieren ist eines, an nicht verarbeitbaren Informationen zu ersticken, ist etwas ganz anderes. Man braucht nicht mal hochsensibel zu sein, dass einem schon die täglichen Nachrichten zusetzen. Aber dadurch dass alles tausendfach geteilt und in allen Einzelheiten gezeigt wird, weil jeder Quote machen oder Aufmerksamkeit haben will, fühlt es sich immer mehr an, als wären wir in einem Horror-Spiegelkabinett gefangen, in dem jedes furchtbare Element unendlich oft widerhallt und wir dem Schrecken nichts mehr entgegensetzen können. Und diesen Schluss zu ziehen, wäre das Schlimmste.
Ich will mich für das Leben entscheiden, für dieses wundervolle, manchmal so schreckliche, immer aber kunterbunte Leben. Für mein Leben und dafür, ein Leben zu führen, das mich nicht in die Ohnmacht und auf die Knie zwingt, sondern eines, in dem ich handlungsfähig bleibe. Nur so kann ich etwas tun. Vielleicht nicht viel, aber auf jeden Fall mehr, als wenn ich mir Katastrophen in allen Facetten anschaue und dadurch immer mehr den Eindruck bekomme, dass eh schon alles zu spät ist. Genau DAS darf ich nicht zulassen, denn dann ist es tatsächlich irgendwann zu spät und zwar für mich, weil keine Energie mehr da ist, kein Sinn und keine Hoffnung. Solange ich aber in meiner Kraft bleibe, geht es weiter, immer.
Wir können alle etwas tun, Kleines und Großes – aber nur dann, wenn wir wirklich ins Handeln kommen und uns unsere kostbare Lebensenergie nicht in der Passivität des Konsums (in diesem Fall Medien-Konsum, gilt aber für mich inzwischen auch für Konsum überhaupt) absaugen lassen. Und ich möchte allen zurufen, denen es ähnlich wie mir geht: Passt gut auf Euch auf, auf Eure Kraft, Eure Hoffnung und auf Eure Verletzlichkeit. Die Welt braucht Menschen, die leben wollen, und nicht noch mehr Angst, Resignation und Depression. Nur indem wir zurück in unsere Kraft finden, können wir mehr vom Guten in die Welt bringen und Wandel gestalten.

Zwischen den Jahren
Ich mag die Zeit zwischen den Jahren. Es sind für mich Tage, in denen der normale Alltag aufgehoben ist: Aufgaben- und verpflichtungsfreie Tage, aber auch kein richtiger Urlaub. Ruhe- und Vorbereitungsphase. Nachklang und Aufbruchsstimmung zugleich.
Seit vielen Jahren habe ich für diese Zeit ein kleines Ritual: Ich erstelle zunächst ein großes (buntes!) Mind Map über das Jahr das nun hinter mir liegt. Dort notiere ich in groben Zügen, was in diesem Jahr alles geschehen ist, was ich erlebt und geschafft habe, welche Themen und Herausforderungen anstanden und auch was schwierig und hart war. Danach fülle ich eine DinA4-Seite (vorne und hinten) zum Thema „Für 2020“ (oder welches Jahr halt kommt). Ich schreibe auf, wo ich gerade stehe, wie ich in diesen Jahreswechsel gehe und welche Gedanken mir in der Kombination Rückblick – Ausblick in den Sinn kommen.
Das Zusammenfassen des vergangenen Jahres zeigt mir, was ich alles bewältigt habe und was es Schönes gab. Der Ausblick gibt mir etwas Klarheit darüber, mit welchem Grundgefühl ich in das neue Jahr gehe. Ich setze mir keine Ziele, aber ich formuliere Wünsche für das kommende Jahr und versuche mein „Wort des Jahres“ zu finden, das sich auch immer nach einer Weile zeigt.
Diese beiden Schritte empfinde ich als sehr wohltuend und ich werde richtig unruhig, solange ich das noch nicht erledigt habe. Erst danach bin ich zufrieden und kann loslassen. Es ist auch immer wieder spannend, dann in den vergangenen Texten und Mind Maps zu stöbern. Manchmal stelle ich fest, an ganz ähnlichen Punkten zu stehen und manchmal unterscheiden sie sich enorm. Immer aber wird mir bewusst, dass ich viel Weg zurückgelegt habe in diesem und den letzten Jahren.
Vielleicht ist das ja eine kleine Anregung auch für andere hier 🙂
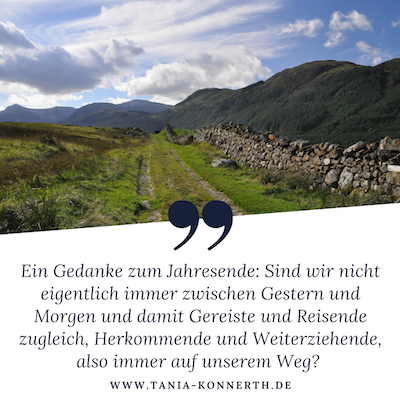
Selbstmitgefühl
Ich erkenne in der Yoga-Praxis, dass ich mich durch meine hohe körperliche Flexibilität immer wieder in Posen bringe, denen ich kräftemäßig nicht gewachsen bin und die mir nicht gut tun. Ich gehe zum Beispiel oft so tief in Dehnungen (einfach weil es mir körperlich möglich ist), dass die Übungen extrem schwer werden. Ich versuche dann, mich zitternd und ringend durchzukämpfen, spüre doch aber sehr genau, dass die Kraft einfach nicht reicht. Und ich begreife langsam: Das ist nichts anderes als ein Bildnis für viele andere Bereiche in meinem Leben …
Im normalen Leben habe ich bisher kaum gespürt, wenn ich mich selbst durch meine mir natürliche Anpassungsbereitschaft immer wieder in Situationen bringe, denen ich eigentlich nicht gewachsen bin, sondern habe mich unbewusst mit purer Willenskraft hindurchgetrieben. Aber der Körper macht nicht mit. Er kann nicht und will nicht und ich kann ihn nicht wollend machen. Yoga zeigt mir also ganz klar Grenzen, Grenzen, die ich mit noch so viel Willen nicht brechen kann – und das ist gut so!
Denn: Scheitere ich deshalb? Bin ich zu schlecht? Versage ich? Nein, im Gegenteil: Ich lerne Mitgefühl mit mir selbst, indem ich mich anrühren lasse von meiner Verletzlichkeit und meinen Grenzen. So wird mir bewusst, wie oft ich selbst es war und bin, die mich verletzt, weil ich nicht gut für mich sorge, wenn ich mich in eine Lage versetze, die – in welcher Beziehung auch immer – zu viel oder nicht gut für mich ist.
Ja, … mich selbst zu fühlen ist immer wieder Herausforderung und Lernaufgabe zugleich.

Vom Weg abgekommen?
Immer wenn ich bisher das Gefühl hatte, von meinem Weg abzukommen oder nicht mehr genau wusste, in welcher Richtung ich eigentlich unterwegs war (und vor allem, ob es noch die richtige war), löste das in mir Unbehagen und Angst aus. Nachdem mein Weg nun aber in den letzten Jahren eigentlich ständig immer wieder in unbekanntes Terrain führte und ich manchmal komplett die Orientierung verlor und nicht mal mehr wusste, was überhaupt noch „richtig“ ist, übe ich mich in Vertrauen:
Ich versuche, mehr und mehr dem Leben zu vertrauen und nicht länger darauf zu bestehen, dass ICH doch „weiß“ wo es lang geht. Genau das weiß ich nämlich meist nicht. Und mehr noch: Die Richtung, in der ich oft unbedingt entlang wollte, war bei Weitem nicht immer gut für mich. Also sage ich mir heute: Wenn ich meinen Weg verliere, muss das nichts Schlechtes sein, sondern kann einfach nur bedeuten, dass der von mir geplante Weg eben doch nicht mein Weg ist, sondern dass „mein“ Weg eben woanders entlang führt und dass es genau richtig so ist, wie es ist.
In dieser Lektion steckt das, was mir bisher so endlos schwer fiel: Ja sagen zu können zu Veränderungen. Mich einlassen zu können und mich hinzugeben. Offen, ohne Wertung, neugierig und gespannt. Von Gutem ausgehend, nicht von Schlechten. Vertrauensvoll.
Nein …, es gelingt mir noch nicht immer und auch nicht immer gut, aber ich übe und ich lerne.

Hingabe ist noch mehr als Loslassen
Auf meinem Yoga-Weg lerne ich nicht nur Bewegungen neu zu erleben und auszuführen, sondern ich lerne auch Begriffe ganz neu zu sehen und zu verstehen.
Dass Loslassen keineswegs immer auch Verlieren bedeutet, habe ich in unendlich vielen Facetten in den letzten Jahren erfahren, doch auch hier erkenne ich immer tiefere Schichten. Während ich die Yoga-Asanas praktiziere, komme ich immer und immer wieder an Punkte, an denen ich merke, dass ich kämpfe: Ich kämpfe gegen den Frust, weil ich mich nicht stark genug fühlte, nicht fit genug, nicht kräftig genug. Vor einigen Tagen wurde mir in genau einem solchen Moment von irgendwoher das Wort „Hingabe“ zugeflüstert und ich war erstaunt, wie fremd mir dieses Wort im ersten Moment war.
Hat Hingabe nicht etwas mit aufgeben zu tun? So habe ich es wohl immer gesehen, genauso wie Loslassen für mich immer gleichbedeutend mit Verlust war. In beiden Fällen lerne ich nun dazu: Wenn ich gegen die Haltung, gegen meine Schwäche oder gegen den Balanceverlust kämpfe, dann kämpfe ich – wie so oft! – gegen das Leben, anstatt mich ihm anzuvertrauen. Gelingt mir hingegen das Loslassen – von Erwartungen, Ansprüchen, Forderungen und dergleichen mehr – gleite ich in den augenblicklichen Moment und darf pures Sein erleben. Dann ist das, was ist, einfach richtig. Und ist nicht genau das Hingabe? Es geht dabei nicht um’s Aufgeben, ganz im Gegenteil: es geht um’s Annehmen: das anzunehmen, was ist, ganz und gar.
Vielleicht ist Hingabe die Meisterschaft des Loslassens?

Von der Schwäche in die Stärke
In meiner täglichen Yoga-Praxis rührt es mich sehr an, dass ich mich oft als kraftlos empfinde:
- zitternde Beine,
- fehlende Standfestigkeit,
- mangelnde Armkraft…
Ich will so viel schaffen und scheitere, weil der Körper nicht mitmacht.
Mich so schwach zu erleben, ist ziemlich unangenehm für mich als eigentlich „toughe“ Macherin – hey, ich bin doch die, die alles schafft!
Und so komme ich wieder direkt an und in meine Verletzlichkeit, immer zu und immer wieder. Doch in mir wächst die Hoffnung, ja, keimt das Wissen, dass genau durch das Wahrnehmen, Aushalten und Erforschen meiner Schwäche echte Stärke entstehen kann.

Mein Yoga-Weg
Es ist schon manchmal ein bisschen beängstigend, wie klar und präzise mich das Yoga an all meine Baustellen führt:
- vermeintliches Wissen, dass sich als irrig herausstellt,
- Themen, die ich bisher nur halbherzig beachtet habe,
- Schlüsse, die ich zu vorschnell gezogen habe,
- Gedanken, die ich für Erkenntnisse hielt, die aber noch lange nicht zu Ende geführt sind,
- offene Fragen, zu denen es noch keine Antworten gibt,
- Irrtümer über mich und andere,
- die Erkenntnis, mein ganzes Leben lang immer wieder vor allem Möglichen weggerannt zu sein
- und das immer noch unzureichend gelebte echte Miteinander mit mir selbst.
Ich dachte eigentlich, ich bin schon ganz gut in Sachen Selbstreflexion und Selbsterkenntnis, aber ich erkenne: der Weg geht weiter und weiter, immer.
Und irgendwie ist das dann wieder sehr tröstlich.

Ich brauche offene Arme
Durch das Yoga rücke ich mir immer mehr selbst auf die Pelle. Der Abstand wird geringer, ich komme mir näher und näher und weiß noch nicht, wie ich das finde. Ich hatte so viele Strategien, genau das im Alltag tunlichst zu vermeiden, doch nun renne, stürze und stolpere ich gleichsam in mich, manchmal ungehalten, ungestützt und mit ganzem Gewicht.
Ich weiß, ich brauche offene Arme, um mich aufzufangen, doch noch traue ich ihrer Kraft noch nicht und fürchte manchmal, mich selbst zu zerdrücken, zu begraben, zu ersticken.
Dann aber ist da meine Hand, mit der ich mir über das Haar streichle, und ich höre diese neu gefundene Stimme, mit der ich leise meinen eigenen Namen sage, und mir versichere, dass alles richtig ist, genau so, wie es eben gerade ist.