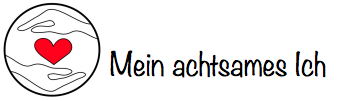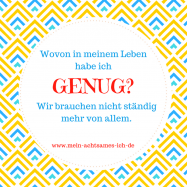Hier finden Sie Reflexionen, Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit.
Das magische Wort „genug“
Wir leben in einer Welt, in der uns ständig vermittelt wird, dass wir nie das Richtige haben oder können, sondern dass genau die eine Sache oder die bestimmte Fähigkeit fehlt, um endlich glücklich zu werden. Werbebotschaften sind dabei genauso laut, aufdringlich und vehement wie gute Ratschläge oder die unzähligen „Tipps“, die wir zu allem Möglichen bekommen. Sie tönen nicht nur davon, WAS wir brauchen, sondern vor allem auch, dass wir immer MEHR von allem brauchen – mehr Dinge, mehr Geld, mehr Ziele, mehr Erfolg, mehr Zufriedenheit und so weiter und so fort. In all dem hilft mir ein magisches Wörtchen und das lautet: Genug!
In dem ständigen Überangebot an Reizen und Möglichkeiten ist es oft gar nicht so einfach, die wirklich eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen und so lassen wir uns oft von all den Angeboten treiben. Die überbieten sich ständig selbst, so dass wir bestellen und kaufen und buchen und hoffen, irgendwann satt zu werden. Doch, solange wir nicht wirklich das finden, das gut für uns ist, werden wir immer hungriger. Dabei haben wir doch alle meist mehr als genug, wenn nicht gar zu viel…
Achtsamkeit schenkt mir die Möglichkeit zu erspüren, was wirklich wichtig für mich ist, was ich wirklich brauche und was mir wirklich gut tut. Natürlich nehme auch ich all die lockenden Angebote wahr, aber wenn ich bei mir bleibe, weiß ich sehr genau, ob ich wirklich gerade einen Schokoriegel, eine neue Tasche oder den 10. Ratgeber für mehr Selbstbewusstsein brauche oder einen elektronischen Selbstoptimierer, eine höhere Position in der Firma, mehr Wertpapiere oder einen weiteren Kurs, um in irgendwas noch besser zu werden – oder… oder… oder…
Ganz oft brauche ich nämlich tatsächlich nichts von all dem, was mir so unwiderstehlich bunt und glitzernd und als heilbringend und unentbehrlich dargeboten wird – nicht noch mehr Sachen, nicht noch mehr zu essen, nicht noch mehr zu tun, nicht noch mehr zu lesen oder anzuschauen, nicht noch mehr zu unternehmen. Ganz oft brauche ich kein Mehr, denn ich habe schon mehr als genug. Im Gegenteil: ganz oft brauche ich weniger.
Das Gefühl, genug zu haben, ist ein sehr mächtiges, denn es schenkt uns Klarheit. Wer genug hat, kann Angebote problemlos ablehnen und kann sagen: „Nein, danke.“ oder auch „Bis hierhin und nicht weiter.“ Und das gut unendlich gut!

Das Leben ist bunt
Ich habe schon oft versucht, Metaphern für das Leben zu finden, denn ich liebe Bilder, mit denen ich viel besser ausdrücken kann, was ich sagen möchte als mit vielen Worten. Manchmal passen solche Bilder punktgenau, bei etwas komplexeren Themen merkt man aber schnell, dass man es eigentlich mit einem Mosaik zu tun hat, also mit vielen verschiedenen Bildern für ein und dieselbe Sache.
Tja, und was gibt es Komplexeres als das Leben?
Eine Metapher, die lange für mich stimmte, war diese: Das Leben ist eine Schule. Die Annahme, dass ich Dinge lernen soll, schien mir eine gute Erklärung für sehr vieles zu sein und ich war mehr als bereit, eine gute Schülerin zu sein. Ich wollte nicht nur lernen, ich wollte auch die Prüfungen gut bestehen. Und da zeigt sich, was dieses Bild auch beinhaltete: dass ich erwartete, irgendwann gute Noten zu bekommen, also Anerkennung. Und so ging ich Deals ein, nach dem Motto: „Hey, wenn ich das jetzt besonders gut mache, dann wird auch alles gut!“
Heute weiß ich für mich, dass es genauso nicht funktioniert. Es geht nicht darum, bestimmte (Lern-)Aufgaben zu erledigen, um gleichsam auf die nächste Stufe zu kommen. Es gibt keinen Prüfer, niemanden, der mir ein Lebenszeugnis oder eine Urkunde überreicht. Diese Erkenntnis ließ mich erstmal ganz schön in der Luft hängen, denn Leistungsorientierung war meine Natur. Sie gab mir das Gefühl, Einfluss nehmen und die Geschehnisse ein Stück weit kontrollieren zu können. Wenn etwas nicht gut lief, musste halt ich nur härter daran arbeiten, die jeweilige (Lern-)Aufgabe zu bewältigen und ich hatte nie ein Problem damit, mich mehr zu pushen. Nur bewahrte ich das nicht vor dem, wovor ich mich drücken wollte: Enttäuschungen, Stürze, Schmerz und ähnliches.
Ich habe dann lange nach einem besseren Bild gesucht. Aber was, wenn es im Leben einfach nur darum geht, Erfahrungen zu machen? Vielfältigste Erfahrungen in allen Farben und Schattierungen. Wenn es nicht um Wertungen geht, nicht um Leistungen, nicht um Ziele oder Erfolg, nicht darum, sich vor irgendetwas drücken zu können, sondern wenn es allein um Erfahrungen geht? Darum, immer wieder mitten hineinzuspringen in die Vielfalt?
Am besten passt für mich deshalb heute dieser Satz: Das Leben ist bunt!
Wer bin ich mit Dir?
Für mich hat sich der Fokus in meinen Beziehungen über die letzten Jahre stark verändert. Früher war ich regelrecht getrieben von der Frage: „Wie kann ich eine Beziehung oder Freundschaft halten, wie verhindere ich also, den anderen zu verlieren?“ Heute hingegen frage ich mich: „Wer bin ich, wenn ich mit dieser Person zusammen bin – kann ich sein, wer ich wirklich bin?“
Interessanterweise hätte ich mich früher mit meinem heutigen Beziehungsfokus wahrscheinlich für egoistisch gehalten, denn damals war ich überzeugt davon selbstlos zu handeln. Schließlich ging es mir doch um den anderen und darum, die Beziehung zu halten, also um das Wir!
Ich weiß heute, dass das so nicht stimmt. Meine Motive waren nicht selbstlos, sondern vor allem angstgetrieben. Ich wollte, dass meine Beziehungen „funktionierten“, weil meine größte Angst war, Menschen zu verlieren. Es war mir wichtiger als alles andere, dass sie hielten. Die Dauer einer Beziehung war für mich ein Qualitätsmerkmal und ich tat sehr, sehr viel dafür, Beziehungen zu halten. Darauf war ich sehr stolz, aber lange nicht alles von dem ich tat war gut…
Nicht nur, dass ich mich für Beziehungen immer wieder selbst verloren habe. Mehr noch, ich war oft jemand, der ich nicht sein wollte. Ausgerichtet auf die Erwartungen des anderen und auf das, was ich an Anforderungen an mich wahrnahm, bediente ich das, von dem ich glaubte und oft auch wusste, dass es nötig war, um die jeweilige Beziehung halten zu können. Da aber vieles davon nicht wirklich mir entsprach, musste ich ein Stück weit jemand anderes sein. Und so tat ich vieles, was falsch war.
In der Rückschau kann ich erkennen, dass ich durch meinen Fokus in vielen Beziehungen tatsächlich ein „schlechteres“ Ich war – und die Wertung hier ist bewusst von mir gesetzt. Sie bringt zum Ausdruck, dass ich für mich heute weiß, dass nur wenn ich wirklich ich selbst sein kann, auch ein „gutes“ Ich bin – gut im Sinne von dem, was ich in die Welt bringen kann, gut in Bezug auf das, was mich ausmacht:
- Nur wenn ich ich selbst in einer Beziehung sein kann, kann ich wirklich geben.
- Und nur dann kann ich auch annehmen, also bekommen, was ich brauche und mir wünsche.
- Nur, wenn ich ich bin, bin ich wirklich ehrlich und authentisch.
- Nur, wenn ich mich ich sein lassen kann, kann ich den anderen so sein lassen, wie er ist.
- Nur wenn ich in einer Beziehung wirklich ich selbst bin, kann ich lieben.
Irrwege und falsche Überzeugungen zu erkennen, ist oft schmerzhaft – gleichzeitig aber sehr befreiend. Ich kann heute verstehen, warum Beziehungen und Freundschaften kaputt gehen mussten und ich erkenne heute besser, welche Beziehungen ich selbst beenden oder reduzieren muss. Ich bin in meinen Beziehungen heute viel gebensfähiger und wahrhaftiger. Ich bin mehr ich.
Trauer ist wie das Meer
Das Thema Trauer begleitet mich weiterhin und so, wie ich immer über das schreibe, was mich selbst berührt und bewegt, schreibe ich weiter darüber. Ich habe ein Bild gefunden, das für mich Trauer sehr anschaulich beschreibt: Trauer ist wie das Meer.
Ich schwimme in meiner Trauer wie in einem Ozean. Manchmal sind da dichte Wälder aus Seegras und Algen, die mich festhalten und regelrecht hinabziehen in eine unendliche Tiefe. Im ersten Moment denke ich, ertrinken zu müssen, doch ich muss mich nur selbst darin erinnern, dass ich Kiemen habe für die Trauer, ja, ich kann auch in der Tiefe atmen. Nicht so leicht wie Luft, aber es ist möglich, Trauer zu atmen und es gilt zu lernen, genau das zu tun: Trauer ein- und wieder auszuatmen, um sie fließen zu lassen.
Trauer kommt oft in Wellen. Mal sind es kleine oder mittlere Wellen, und in ihren Bewegungen können wir uns auf den Schmerz einlassen, der wie in Wehen kommt. Manche Wellen aber brechen mit einer Wucht über uns hinweg, dass wir weit fortgespült oder zum Boden gedrückt werden. Und wieder gilt es, nicht zu vergessen, dass wir auch in der Trauer atmen können, mehr noch: atmen müssen, denn atmen heißt leben.
Dann gibt es Zeiten, in denen treiben wir scheinbar ganz allein auf der unendlichen Weite unserer Trauer, kein Land in Sicht, kein rettendes Schiff. Für diese Zeiten brauchen wir uns selbst so sehr und unser Ja zu dem, was da gerade ist an Schmerz und Tränen. Denn es ist dieses Ja, das unsere Planke ist, mit der wir oben bleiben und nicht untergehen.
Dieses Ja lässt uns auch Ausschau halten nach fliegenden Fischen, Delphinen und den Möwen, die uns ein Stück begleiten, denn tatsächlich sind wir auch im tiefsten Schmerz nie ganz allein. Und dieses Ja ermöglicht uns, das Glitzern auf dem Wasser zu sehen und die Sonne zu spüren, die uns wärmt und die Leuchttürme zu entdecken, die uns zeigen, dass es jenseits der Trauer festes Land gibt. Dieses Ja trägt uns durch die Trauer, weil es uns wissen lässt, dass es außer dem Schmerz auch Freude gibt, dass da nicht nur Tränen sind, sondern auch Lachen und dass im Loslassen in Dankbarkeit so viel Linderung zu finden ist.
Trauer ist wie das Meer, eine ganz eigene Welt. Trauer im Ja ist gelebte Liebe.
Der Weg durch die Trauer
Ein achtsamer Weg durch die Trauer ist für mich zunächst ein Weg direkt in den Schmerz. Es geht darum, die Arme weit für ihn zu öffnen und auch zu ihm ja zu sagen, denn einen Kampf gegen ihn kann ich nicht gewinnen.
Wer einen geliebten Menschen oder ein geliebtes Tier verliert, steht zunächst fast immer erstmal unter Schock. Auch wenn die Tränen schon fließen und es auch schon höllisch weh tut, so wirken in der ersten Phase noch Schutzmechanismen der Psyche, die einen nur zum Teil verstehen lassen, was der Verlust wirklich bedeutet. Man kann es vielleicht zwar mit Worten formulieren und weiß auch vom Verstand her, dass das Wesen für immer weg ist, wirklich begreifen tut man es aber erst viel, viel später.
Erst mit der wachsenden Ahnung davon, was es heißt, von nun an tatsächlich ohne diesen Menschen oder das Tier leben zu müssen, setzt die richtige Trauer ein. Dieses Begreifen braucht oft viel Zeit und setzt entsprechend zeitversetzt ein. Der Schmerz kommt dann Stück für Stück mit jedem Tag und jeder Woche. Je mehr man zu verstehen beginnt, was „nie wieder“ tatsächlich bedeutet, desto roher wird man und steht da wie aufgerissen.
Viele versuchen, diesen Schmerz zu vermeiden, indem sie sich ablenken, ihn verdrängen, zu Alkohol oder Drogen greifen oder sich in (Arbeits-)Projekte stürzen. Für manch einen mag das ein guter Weg sein, ich für mich weiß aber, dass ich in die Trauer hinein muss, tief in den Schmerz und das mit einem Ja. Ich muss hindurch, um verarbeiten zu können, es führt für mich kein Weg daran vorbei, denn mein Schmerz gehört zu mir.
Das Licht in der Dunkelheit der Trauer ist meine tiefe Dankbarkeit über das was war, über das, was ich erleben durfte und bekommen habe. Sie nimmt mich an die Hand und führt mich in die maßlose Tiefe des Schmerzes – und sie wird mich auch wieder hinausführen. Denn in dieser Dankbarkeit steckt all meine Liebe. Und die Liebe überdauert die Trauer.
Bitte, versteh mich doch!
In Beziehungen zu anderen Menschen war und ist mir eines sehr wichtig: Ich möchte verstehen und ich möchte verstanden werden. Entsprechend habe ich sehr viel Zeit und Energie darauf verwendet, mich selbst zu erklären und mein Verhalten und meine Beweggründe zu motivieren. Auf diese Weise habe ich viele Menschen tief in mich schauen lassen, was manchmal gut und manchmal nicht gut war. In den letzten Jahren zieht sich nun eine Erkenntnis durch mein Leben, die schmerzlich und befreiend zugleich ist:
Ich kann nicht von jedem verstanden werden.
Wenn ich zurückschaue, dann steckt hinter sehr vielem, was ich tat, der dringende Wunsch „Bitte, versteh mich doch!“ Geboren ist dieser Wunsch aus der Vorstellung, dass wenn ich mich verständlich machen kann, der andere mich besser annehmen kann. Ich habe gedacht, dass wenn ich es schaffe, dass andere mich verstehen, Akzeptanz folgen muss.
Dabei habe ich allerdings zwei Denkfehler gemacht:
- Ich kann keinen anderen Menschen „verstehend machen“, wenn dieser nicht verstehen will oder kann. Allein in dem Anspruch erkenne ich heute, dass ich meinerseits mein Gegenüber nicht so annehmen konnte, wie er ist, sondern ich wollte etwas auf seiner Seite verändern, um etwas für mich besser zu machen. Keine allzu noble Intention…
- In Sachen Akzeptanz beim anderen anzusetzen kann nicht funktionieren, denn ICH muss mich selbst annehmen, unabhängig davon, ob andere mich verstehen oder zu dem, was ich tue oder sage nicken – nichts davon hilft bei der Selbstannahme, auch wenn wir das immer wieder glauben.
Den Satz „Bitte, versteh mich doch!“ richte ich heute vor allem an mich selbst, denn genau darum geht es bei dem, was man Selbsterkenntnis nennt: sich selbst sehen und verstehen zu lernen – nicht für andere, sondern für sich. Die Sehnsucht, verstanden zu werden, ist für mich vor allem eine Sehnsucht danach gesehen zu werden – und hier komme ich immer wieder an den Punkt, an dem mir klar wird: das kann und muss ich mir vor allem selbst geben.
Weniger fühlen – nein danke!
„Nimm Dir das doch nicht so zu Herzen!“ oder „Du darfst das nicht so an Dich herankommen lassen.“ – das sind Sätze, die ich schon oft gehört habe. Gut gemeinte Ratschläge, die aber leider gar nicht gut für mich sind, denn weniger fühlen ist aus meiner Sicht der falsche Weg, weil der Preis dafür viel zu hoch für mich ist.
Zugegeben, es klingt logisch und sinnvoll: Menschen, die viel an sich heranlassen, werden auch schnell verletzt – im Umkehrschluss gilt es sich zu schützen, in dem man weniger an sich heranlässt, weniger fühlen muss und so auch weniger verletzt wird. Vielleicht funktioniert das für manch einen, für mich hat es nie funktioniert und ich habe wirklich vieles getan, um weniger an mich heranzulassen. Das Ergebnis war jedes Mal, dass ich mich selbst verloren habe und in der Summe viel mehr Schmerz erlebt habe, als wenn ich mich in meiner Empfindsamkeit angenommen hätte, denn ein Kampf gegen meine Gefühle ist ein Kampf gegen mich selbst.
Ja, ich bin ein intensiv fühlender Mensch. Intensiv fühlen zu können macht mein Leben und mein Sein aus. Und ja, ich bin dadurch verletzlich, aber genau das liegt in der Natur der Sache bzw. in meiner Natur. Weniger fühlen zu wollen, um mich zu schützen, geht also gegen meine Natur.
Ich bin inzwischen überzeugt davon, dass der größte Schmerz nicht durch das entsteht, was wir an uns heranlassen, sondern durch Selbstablehnung. Wenn ich mich abzuschotten versuche, sage ich mir damit, dass ich mit meiner Empfindsamkeit nicht ok bin. Ich will dann anders sein, um besser zu funktionieren oder um nicht so aufzufallen oder schlicht und einfach aus Angst – alles Motive, mit denen ich Nein zu dem sage was ist, also Nein zu mir.
Ja zu mir zu sagen, heißt meine Empfindsamkeit nicht als Schwäche zu sehen, sondern als Geschenk. Ich bin so und ich darf so sein.
Ich kann heute meine Empfindsamkeit immer besser leben, da ich lerne, dass ich nicht nur in der Lage bin, sehr intensiv zu fühlen, sondern ich kann genau das auch aushalten! Durch den Blick anderer auf mein Sein habe ich oft die Botschaft erhalten, dass ich aufpassen und mich schützen muss – aber das waren die Ängste der anderen, nicht meine! Ich will fühlen, mehr noch: ich MUSS fühlen. Das ist mein Sein. Versuche ich mich abzuschotten, verliere ich so vieles von dem, was mich ausmacht, fast wie ein emotionaler Zombie…
Erst wenn ich mich in meinem eigenen Sein wirklich annehme, wird es mir möglich, gut für mich zu sorgen, ohne gegen mich zu handeln.
Achtsam traurig sein
Ich gebe es offen zu: Ich bin gerne auch mal traurig. Traurigkeit ist ein sehr tiefes Gefühl, eines das mir meine Empfindsamkeit besonders deutlich macht und das einfach zu mir gehört.
Nun liegt es nicht gerade im Trend, traurig zu sein, denn schließlich gilt es doch, sich von Gefühlen nicht beherrschen zu lassen – schließlich haben wir uns doch alle so gut im Griff, nicht war? Tja, und da schwimme ich mal wieder etwas gegen den Strom, denn achtsam zu sein, heißt für mich Gefühle nicht zu verdrängen, sondern sie anzunehmen und zu leben. Und mehr noch: Ich neige manchmal sogar dazu, meine Traurigkeit vor anderen zu verteidigen. Dann bin ich, ohne es zunächst zu merken, schroff und ja, manchmal auch aggressiv.
Der Grund dafür ist, dass ich die Blicke anderer auf mich, wenn ich traurig bin, nicht mag und am liebsten zu vermeiden versuche. Denn andere wollen oft vor allem eines: meine Traurigkeit verändern. In dem sicher gut gemeinten Versuch einem zu „helfen“, wird dann getröstet oder vom Tisch gewischt, es wird relativiert oder kleingeredet, es werden Vorschläge gemacht oder Witze gerissen, um mich zum Lachen zu bringen. Wie gesagt, ich kann erkennen, dass all das gut und nett gemeinte Aktionen sind – aber, gut gemeint ist leider nicht immer tatsächlich auch wirklich gut gemacht.
Denn Traurigkeit ist wichtig. Es gibt in jedem Leben Gründe, traurig zu sein und Gründe zum trauern. Wenn ich das verdränge oder für andere fröhlich zu sein versuche, verliere ich etwas das fundamental zu mir gehört.
Wenn ich traurig bin, brauche ich keine Aufmunterungen und keine Ablenkungen. Ich brauche auch keine Ermahnungen oder schlaue Tipps, mit denen ich mich „besser“ fühlen kann. Und am allerwenigsten brauche ich eine Bewertung meiner Traurigkeit oder meines Seins.
Am meisten brauche ich Raum für mein Gefühl und ein Ja zu dem, was ist.
Am liebsten bin ich tatsächlich allein, wenn ich traurig bin, weil dann alles genau so sein darf, wie es ist: Manchmal sind traurige Momente sperrig und zickig, manchmal verzerrt und duster, oft sind sie auch ganz zart und eigen und, wenn sie wirklich sein dürfen, in ihrer Tiefe auf ihre Art auch wunderschön.
Ich habe festgestellt, dass mir meine Traurigkeit sehr viel von meinem kreativen Tun ermöglicht. Aus ihr entstehen Texte und Bilder, Ideen und Impulse. Wenn ich mich traurig sein lasse und das ganz unbeeinflusst leben kann, ist das eine unerschöpfliche Quelle für mich. In meinem Traurigsein bin ich mir sehr nah.
Und was, wenn ich anders bin?
„Sei wer du wirklich bist!“ ist das Credo der meisten Erfolgsratgeber und Selbsthilfeangebote. Klingt gut und richtig, doch greift es zu kurz: Das Problem ist, dass eben gerade das viele von uns nicht KÖNNEN, denn viel stärker wirkt ganz oft ein inneres Programm, das so etwas besagt, wie „Wenn ich anders bin, dann lehnt man mich ab.“
Das ist wieder einmal ein Thema, bei dem das zum Tragen kommt, was ich unter Achtsamkeit verstehe: Es geht darum, erst einmal wahrzunehmen, was ist. Denn wenn ich einfach nur all den schönen, guten und sicher oft richtigen Ratschlägen anderer nacheifere, werde ich zwangsläufig immer wieder scheitern. Denn wäre es mir möglich, das so zu machen, wie mir andere raten, würde ich es ja einfach tun. Aber wir alle haben aus unserer Lebensgeschichte heraus bestimmte Muster und Glaubenssätze gebildet, die uns so sein lassen, wie wir gerade sind – und das eben auch dann, wenn wir „eigentlich“ vielleicht ganz anders sind. Die aktuellen (meist über lange Zeit gewachsenen) Muster und Überzeugungen verhindern wirkungsvoll, dass wir in diesem Moment anders sein können, selbst dann, wenn wir dann viel mehr wir selbst wären.
Ich glaube, genau das müssen wir erst einmal verstehen, um uns auf einen neuen Weg machen zu können, denn sonst passiert Folgendes: Wir wollen uns ändern, schaffen es nicht, verurteilen uns dafür und beginnen gegen uns selbst zu kämpfen. Damit verstärken wir aber nur die negativen Muster, die eh schon verhindern, das wir „einfach nur wir selbst sein können“. Es kommt auf diese Weise immer mehr Druck und Zwang in unseren Umgang mit uns selbst und wir entfernen uns immer mehr von uns, weil wir uns selbst immer weniger vertrauen können.
Auch hier steht für mich an, erst einmal hineinzuspüren in das, was ist:
- Wann bin ich wie und warum bin ich jeweils so?
- Was hat es für Gründe, dass ich manchen Menschen gegenüber so bin und anderen vielleicht nicht?
- Wieso kann ich manchmal einfach nicht anders sein, so sehr ich auch möchte?
- Warum entscheide ich mich immer wieder, nach außen ein so anderes Bild abzugeben, als ich doch eigentlich wirklich bin?
- Was ist der Preis dafür?
- Und was habe ich davon?
Es gilt, den Schmerz zu verstehen, der hinter dem Phänomen steckt, dass wir uns selbst unser wahres Sein nicht erlauben können. Da sitzen nämlich oft ganz massive (Verlust)Ängste von sehr verletzlichen Teilen in uns.
Ich bin davon überzeugt, dass niemand aus Spaß vorgibt, jemand anders zu sein, sondern fast immer aus Not. Gerade die Fassaden, die wir nach außen aufbauen oder auch unsere typischen Verhaltensweisen, über die wir selbst manchmal den Kopf schütteln, sind ganz oft nichts anderes als Überlebensstrategien bzw. sie waren es einmal.
„Eigentlich bin ich ganz anders“ ist deshalb für mich eine Aussage, die selten wirklich so stimmt, denn Fakt ist viel mehr ganz oft: „Genauso bin ich gerade (und kann oft eben gar nicht anders sein!)“ – und DAS gilt es, glaube ich, zu erkennen, zu fühlen und anzunehmen. Denn nur in diesem Ja zu sich, so wie wir JETZT sind, steckt die Chance zur Aussöhnung und zum behutsamen Loslassen (wenn auch nur zeitweise), wodurch wiederum überhaupt erst Raum entstehen kann für anderes.
Stichwort: Komfortzone
Gerade bin ich wieder zurück von einer meiner Reisen und was für eine Reise das war! Relativ unvorbereitet bin ich in eine regelrechte Wundertüte gesprungen, die mich vom ersten Moment an komplett aus meiner persönlichen Komfortzone geschleudert und immer wieder munter durchgeschüttelt hat.
Ja, die Sache mit der Komfortzone… – dieser so trügerisch gemütliche und so scheinbar sichere Bereich, in dem wir uns liebend gerne aufhalten, weil dort alles vertraut und leicht wirkt. In unserem persönlichen Wohlfühlbereich ist alles überschaubar und es warten wenige Überraschungen auf uns. In ihm können wir uns der Illusion hingeben, alles im Griff und alles unter Kontrolle zu haben. Unsere Komfortzone lässt uns glauben, dass sie uns alles bietet, was uns glücklich und zufrieden macht.
Meine Erfahrung ist allerdings eine ganz andere. Komfortzonen haben nämlich eine entscheidende Eigenschaft, die den wenigsten von uns bewusst zu sein scheint: sie schrumpfen stetig.
Wenn wir uns ausschließlich innerhalb unseres Wohlfühlbereiches bewegen, dann zieht sich dieser langsam und stetig immer mehr zusammen. Oder anders formuliert: je mehr wir in unserem persönlichen Sicherheitsbereich verharren, desto mehr wird im Außen unbequem und zunehmend bedrohlich wirken. Das Nährende wird also immer weniger, während das Bedrohliche wächst.
Genau das wiederum führt dazu, dass wir uns mehr und mehr vor unbekannten Einflüssen zu schützen versuchen. Nicht wenige beginnen, die gedachte Linie des Wohlfühlbereiches immer vehementer zu verteidigen und regelrechte Mauern zu ziehen. Und damit wiederum wird es immer schwieriger, die Komfortzone auch mal zu verlassen und irgendwann bleibt nur noch ein sehr kleiner Bewegungsraum, in dem wir uns angstfrei bewegen können.
Seitdem mir das klar geworden ist, achte ich darauf, mich nicht von dem vermeintlichen Sicherheitsgefühl, das ich in meinem persönlichen Wohlfühlbereich habe, einlullen und betäuben zu lassen. Komfortzonen können sehr leicht zu einem Gefängnis werden, denn ihre Wände kommen immer und immer näher. Deshalb suche ich inzwischen gezielt nach Türen, die ich weit öffnen kann (und nicht nur nach Fenstern, durch die ich die Welt draußen beobachten kann…). Und notfalls bin ich bereit, auch Wände und Mauern einzureißen, wenn es nötig ist, denn ich will mich frei bewegen können!
Reisen ist natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten, sich immer wieder ganz bewusst auf Unbekanntes einzulassen, um den eigenen Horizont zu erweitern und die Grenzen des Wohlfühlbereiches flexibel und dehnbar zu halten. Sich frische Projekte oder Herausforderungen zu suchen, etwas ganz Neues zu lernen oder auch gezielt andere Menschen kennen zu lernen, all das und vieles mehr bringt uns an die Grenzen unseres angenommenen Wohlfühlbereiches. Überschreiten wir diese, so erkennen wir oft, dass uns vieles gut tut, von dem wir es gar nicht ahnten, dass also unsere Komfortzone viel größer ist, als wir es annahmen! Und an den Sachen, die uns wirklich fordern, können wir wachsen, denn auch Unbequemes und ja, auch Angstauslösendes zu bewältigen, fühlt sich im Nachhinein oft großartig an, selbst dann, wenn wir für uns entscheiden, das nicht noch einmal erleben zu müssen.